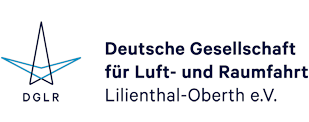Von Eislawinen bis Getreidesilos: Experiment zur Erforschung von Granulaten startet zur ISS
Granulate bestehen aus vielen kleinen, festen Partikeln wie Körnern oder Kugeln. Sowohl Getreide in einem Silo als auch Aufschüttungen von Kies gehören zu den granularen Medien. Aber auch Eiskristalle in Schneelawinen oder Steine in Erdrutschen gehören zu den granularen Systemen. Viele weitere Bespiele finden sich in der Verfahrenstechnik, der pharmazeutischen Industrie und der Bauindustrie sowie Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, überall dort wo mit Körnern und Pulvern gearbeitet wird. Granulate werden weltweit im großen Maßstab verarbeitet oder betreffen Menschen und Infrastruktur bei Naturkatastrophen. Daher ist es wichtig, ihre Eigenschaften genau zu bestimmen, um ihr Verhalten voraussagen zu können. Dies soll im Experiment Granular Sound Characterization (GraSCha) geschehen.
Es ist am 15. September 2025 mit einer Cygnus-Versorgungskapsel zur Internationalen Raumstation ISS gestartet und wird dort bis 2026 durchgeführt werden. Es wurde vom DLR-Institut für Frontier Materials auf der Erde und im Weltraum und der Universität zu Köln entwickelt. Der Bau der ISS-Experimentanlage wurde im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR mit Mitteln des Bundes von der Firma OHB durchgeführt.
Welche Kräfte herrschen in Granulaten?
Granulate haben messbare Eigenschaften wie Elastizität und Schallgeschwindigkeit, die charakteristisch für Festkörper sind. Anders als bei herkömmlichen Festkörpern sind dies jedoch keine festen Materialeigenschaften. Sie hängen stark davon ab, wie die Teilchen untereinander angeordnet sind, wie sie verdichtet wurden und ob sie durch äußere Kräfte in Bewegung versetzt werden. Unter Einfluss der Schwerkraft fließen Granulate, beispielsweise Sand in einer Sanduhr, oder Salz aus einem Salzstreuer. Ohne äußere Anregung verliert das Granulat seine Energie durch die Stöße der einzelnen Teilchen aneinander und es kommt zur Ruhe. Dieses Verhalten granularer Medien kann nicht nach der klassischen Thermodynamik beschrieben werden. Sie setzt ein sogenanntes thermisches Gleichgewicht voraus. Das bedeutet, dass alle abgeschlossenen Systeme einem Zustand zustreben, in dem kein Wärmeaustausch erfolgt. Granulate kommen jedoch zur Ruhe, weit bevor sie diesen sogenannten optimalen Zustand erreicht haben.
Dieses Verhalten ist auf der Erde schwer zu untersuchen. Befindet sich Granulat in einem Gefäß, lässt sich der Druck auf die einzelnen Granulatpartikel nicht einfach beschreiben. Wie bei Flüssigkeiten herrscht am Boden ein höherer Druck als oben. Der genaue Verlauf des Drucks hängt hier im Gegensatz zu Flüssigkeiten wesentlich von der Reibung zwischen den einzelnen Partikeln ab. Ein Teil des Gewichts des Granulats wird durch Reibung an den Wänden des Gefäßes getragen. Diese inhomogene Druckverteilung aus dem Zusammenspiel von Schwerkraft und Reibung verursacht zudem auch eine ungleiche Verteilung der Kugeln. Nur in Schwerelosigkeit lässt sich im Granulat ein durchgängig gleicher Druck realisieren, der zudem prinzipiell beliebig klein eingestellt werden kann.
Wie verhalten sich Granulate in Schwerelosigkeit?
Ziel von GraSCha ist es, Erkenntnisse über die innere Struktur von Granulaten zu erhalten. Dabei ist vor allem der Bereich interessant, in dem die einzelnen Teilchen kurz davor sind, ihren gegenseitigen Kontakt zu verlieren. Hier kann bereits die geringste Störung zu einem Verlust der Stabilität führen. Bekannte Phänomene auf der Erde sind beispielsweise Sand, der zu rieseln beginnt, oder ein Erdrutsch der sich löst.
Das Experiment besteht aus einem Kasten, der mit kleinen Glaskugeln gefüllt ist. Eine Wand der Probenzelle kann bewegt und so der Druck auf die Glaskugeln eingestellt werden. Abhängig vom Druck bildet sich eine unterschiedlich lose oder dichte Kugelpackung aus. Anschließend werden Schallsignale auf die unterschiedlich dichten Kugelpackungen gegeben. Aus der Zeit, die der Schall für den Weg durch die Kugeln braucht, wird die Schallgeschwindigkeit ermittelt. Über das Nachschwingen nach dem Durchgang der Welle – vergleichbar mit schwachen Nachbeben nach einem Erdbeben – können zudem verschiedene Zustände der Granulatpackung unterschieden werden. Daraus kann man Rückschlüsse ziehen: Einerseits auf die innere Struktur der Packung, andererseits auf den genauen Mechanismus, der bei verschwindendem Druck zum Verlust der Stabilität führt.
Quelle: https://www.dlr.de/de/aktuelles/nachrichten/2025/granular-sound-characterization-grascha