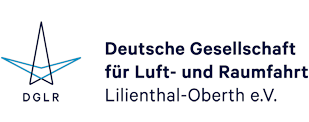Wassereis auf dem Mond – aufgespürt per Simulation in der LUNA-Halle
Dass es Wassereis auf dem Mond gibt, ist sehr wahrscheinlich. Zum Beispiel im Südpol-Gebiet, wo manche Krater noch nie Sonnenlicht gesehen haben. In diesen „Kältefallen“ versteckt sich womöglich seit Milliarden von Jahren Wassereis. Können Menschen das Wasser nutzen, wenn sie auf den Mond zurückkehren? Ist das Wasser fest eingefroren im Mondstaub, ist es chemisch gebunden oder befinden sich sogar Eisschichten in den schattigen Kratern, an der Oberfläche oder im Untergrund? Es gibt eine Menge offener Fragen. Um den Antworten näher zu kommen, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zusammen mit mehreren Universitäten getestet, wie sich Wasser auf dem Mond aufspüren lässt. Schauplatz war die LUNA-Anlage in Köln, wo robotische und astronautische Mondmissionen realitätsnah vorbereitet werden können.
LUNA bietet Forschenden unter anderem eine 700 Quadratmeter große Fläche, die mit Mondstaub-Simulat gefüllt ist. Das Material ist dem Regolith auf dem Mond täuschend ähnlich und eignet sich deswegen zum Testen von Messwerkzeugen und Robotern. „Wenn wir Wassereis auf dem Mond finden und kartieren wollen, müssen wir auf der Oberfläche sehr beweglich sein. Deswegen hatten wir zwei Rover im Einsatz, die mit speziellen Instrumenten unterwegs waren. Die Kombination von unterschiedlichen Methoden bringt Vorteile und erwies sich auch hier als besonders zuverlässig“, erklärt Nicole Schmitz vom DLR-Institut für Weltraumforschung. Sie hat die Polar Explorer Kampagne gemeinsam mit dem LUNA-Team geleitet. Die ersten Ergebnisse stehen schon fest: Die Forschenden waren erfolgreich – sie haben das simulierte Wassereis in der LUNA-Halle gefunden und kartiert. Die gewonnenen Daten werden nun detailliert ausgewertet.
Wie findet man Wassereis in einer Mondsimulation?
Die Deep-Floor-Area in der LUNA-Halle ist drei Meter tief und bis zum Rand mit Regolith gefüllt. In ihr ist nicht nur eine Lava-Höhle verborgen, sondern auch unzählige Acrylglas-Elemente. Für die eingesetzten Radar-Instrumente erscheinen diese wie pures Wassereis, das sich unter der Oberfläche versteckt: Der Kontrast zwischen purem Eis und Mond-Regolith ähnelt stark dem zwischen Acrylglas und LUNA-Regolith. Genau das erkennt ein Radar. Eine seismische Quelle (PASS – Portable Active Seismic Source) hat für die Polar Explorer Kampagne zusätzlich messbare Schwingungen erzeugt, die das simulierte Wassereis im Boden sichtbar gemacht haben. Dazu wurde vorher ein Glasfaserkabel ausgelegt, das auch auf dem Mond verlegt werden könnte. Die Struktur bildete ein eigenes geophysikalisches Netzwerk für das sogenannte Distributed Acoustic Sensing (DAS). Winzige Verformungen der Glasfaser zeigen Bewegungen des Bodens an, die auf die Struktur des Untergrunds schließen lassen.
Auch in Mondgestein wurde bereits Wasser nachgewiesen, das zum Beispiel im Kristallgerüst von Mineralkörnern oder in vulkanischem Glas eingeschlossen sein kann. Zur Detektion des Wasserstoffs in Gesteinsproben haben die Forschenden ein sogenanntes LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) eingesetzt. LIBS verwendet einen gepulsten Laser, um aus dem Probenmaterial eine kleine Plasmawolke zu erzeugen. Das Licht des Plasmas liefert Informationen über die elementare Zusammensetzung des Materials. Das LIBS steckt in einer Nutzlast-Box, ein Roboterarm hält es direkt auf das Ziel. Der Roboterarm wiederum gehört zu LRU2 (Lightweight Rover Unit 2), einem Rover aus dem DLR-Institut für Robotik und Mechatronik.
LRU2 kann mit seiner Ausrüstung nicht nur Laser-Boxen halten, sondern auch Proben einsammeln und seine Aufgaben autonom ausführen und berechnen. Er bildet ein Rover-Team mit LRU1. LRU1 kartiert die Mondoberfläche visuell und in 3D. Dazu nimmt er die Oberfläche mit einer multispektralen Stereo-Panorama-Kamera auf, die an seinem breiten „Kopf“ gut zu erkennen ist. Solche Kameras sehen weit mehr als „nur“ Farben. Sie messen Bilddaten in Wellenlängenbereichen, die weit über das hinausgehen, was das menschliche Auge wahrnehmen kann. Auf dem Mond können so Informationen über die mineralogische Zusammensetzung der Oberfläche erfasst, kartiert und quantifiziert werden. Nebeneffekt: Der Rover findet mit dem Geländemodell auch die für ihn sicherste Strecke zum Ziel.
Für die Polar Explorer Kampagne hat LRU1 einen Anhänger mit einem Bodenradar hinter sich hergezogen und den Untergrund „durchleuchtet“. Verknüpft mit den Daten der Kamera erhalten die Forschenden eine dreidimensionale Darstellung des untersuchten Gebiets, sowohl von der Oberfläche als auch vom Untergrund. Bei einer Mondmission wären die Instrumente natürlich nicht auf einem Anhänger, sondern fest im Inneren des Rovers verbaut.
Erfolgreiche Generalprobe für ein komplettes Missionskonzept
Die Kampagne geht zurück auf ein Missionskonzept, das die Forschenden des DLR der Europäischen Weltraumorganisation ESA vorgeschlagen haben. Das Missionskonzept könnte ausgewählt werden, um mit dem Argonaut-Lander in Zukunft zum Mond zu fliegen. Ein Modell des Argonaut-Landers steht in der LUNA-Halle. Es handelt sich um ein Raumfahrzeug, das Infrastruktursysteme, Instrumente und Ressourcen bereitstellen soll. „Im Rahmen dieses Missionskonzepts haben wir nun erstmals alle Elemente zusammengebracht: Die Teams mit den Rovern und Instrumenten haben den kompletten Betriebsablauf getestet. Sie haben gezeigt, dass alle Elemente parat sind und funktionieren“, ergänzt Nicole Schmitz.
Vom Ätna in die LUNA-Halle
LRU1 und LRU2 kennen sich aus mit unwegsamem Gelände: Sie haben sich schon bei Trainingsmissionen auf dem Vulkan Ätna (Italien) bewährt: LRU1 und LRU2 haben bei der ARCHES-Mission im Team mit anderen Robotern die Gegend erkundet und Proben genommen. „Auch jetzt in der LUNA-Halle haben die Rover autonom navigiert, Hindernisse umfahren sowie die passenden Instrumente ausgewählt und eingesetzt. Alle unsere Ziele in der Polar Explorer Kampagne wurden erreicht“, sagt Dr. Martin Görner vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik. Die Rover sind außerdem mit den schwierigen simulierten Lichtverhältnissen zurechtgekommen: In den Polarregionen des Mondes steht die Sonne immer nur flach über dem Horizont und blendet die Kamerasysteme. Ein Sonnensimulator in der LUNA-Halle erzeugt diesen Effekt.
Wie kam eigentlich das Wasser auf den Mond?
„Früher waren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, dass der Mond staubtrocken ist“, erklärt die Planetenforscherin Nicole Schmitz. „Jetzt haben wir viele Hinweise, dass es Wassereis auf dem Mond gibt – und gleichzeitig sehr viele offene Fragen. Das ist extrem spannend.“ Das Eis könnte etwa mit Einschlägen von Kometen oder eisigen Mikrometeoriten angekommen sein. Oder aus einer Wechselwirkung von Sonnenwind und Mondstaub stammen. Eventuell ist es ein Überbleibsel aus frühem Mondvulkanismus. „Wenn wir das Rätsel lösen, lernen wir auch mehr über die Entwicklungsgeschichte des Sonnensystems“, sagt Nicole Schmitz.
Wassereis ist zusätzlich ganz wesentlich für die Exploration: Wenn Menschen auf dem Mond arbeiten und leben, brauchen sie Zugang zu Ressourcen. Trinkwasser ist ein wichtiges Thema. Wenn das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, kann daraus auch Raketentreibstoff hergestellt werden.