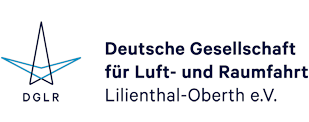ESA-Satelliten verfolgen Fortschritte bei den Zielen des Pariser Abkommens
Während die Klimakonferenz COP30 der Vereinten Nationen in Belém, Brasilien, stattfindet, richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf das Herz des Amazonas-Regenwaldes – eine Region, die sowohl Hoffnung als auch Sorge im Kampf gegen den Klimawandel symbolisiert.
Einst als einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher der Erde angesehen, zeigt der Amazonas nun beunruhigende Anzeichen – Satellitenbeobachtungen zeigen, dass Teile dieses riesigen Ökosystems nicht mehr wie früher Kohlendioxid absorbieren. In einigen Gebieten ist der Wald sogar zu einer Nettoquelle für Kohlenstoffemissionen geworden. Diese sich abzeichnende Veränderung unterstreicht eine dringende Notwendigkeit: die unabhängige, zuverlässige und kontinuierliche Überwachung der Treibhausgasemissionen weltweit.
Wenn sich politische Entscheidungsträger aus aller Welt versammeln, um die Fortschritte im Rahmen des Pariser Abkommens zu bewerten – dem internationalen Vertrag, der das Ziel festgelegt hat, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen –, benötigen sie umsetzbare, wissenschaftlich fundierte Informationen, um Klimaschutzmaßnahmen zu überprüfen, den Temperaturanstieg zu begrenzen und Widerstandsfähigkeit gegenüber unvermeidbaren Auswirkungen aufzubauen.
Die von der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelten Erdbeobachtungsmissionen bieten genau diese Möglichkeit – sie liefern unabhängige, satellitengestützte Beweise, die eine Rechenschaftspflicht im Klimabereich ermöglichen.
Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Erdbeobachtung liefert die ESA transparente und zuverlässige Daten, mit denen Länder ihre Fortschritte verfolgen und nationale Klimaschutzmaßnahmen verstärken können.
Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht die Klimaschutzinitiative der ESA, die langfristige satellitengestützte Datensätze erstellt, die den wesentlichen Klimavariablen entsprechen – den vom Global Climate Observing System definierten Schlüsselaspekten des Klimas. Diese Aufzeichnungen bieten Klimaforschern weltweit eine solide wissenschaftliche Grundlage, auf der wirksame Strategien zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen entwickelt werden können.
Darüber hinaus liefert die ESA durch die regionale Bewertung des Kohlenstoffkreislaufs und -prozesses (RECCAP-2) und ähnliche Projekte die Forschungsergebnisse und Daten, die zur Umsetzung des Pariser Abkommens erforderlich sind.
Quantifizierung des Kohlenstoffbudgets: Jede Tonne zählt
Eine grundlegende Kennzahl, die für wirksame Klimaschutzmaßnahmen von Bedeutung ist und verstanden werden muss, ist das globale Kohlenstoffbudget. Es bestimmt den Umfang und die Dringlichkeit der erforderlichen Maßnahmen. Angesichts des Ziels des Pariser Abkommens, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, beläuft sich das verbleibende Kohlenstoffbudget – die Menge an Kohlendioxid, die wir noch ausstoßen dürfen – im Januar 2025 auf etwa 235 Gigatonnen. Bei den derzeitigen Emissionsraten könnte dieses Budget innerhalb von nur sechs Jahren aufgebraucht sein.
Um dieses Budget zu verstehen, muss man zwei wichtige Faktoren genau kennen: Wie viel Kohlenstoff wird von natürlichen Senken – vor allem Ozeanen und Land – absorbiert und wie viel wird durch fossile Brennstoffe und Landnutzungsänderungen ausgestoßen?
Während die Kohlenstoffsenken der Ozeane relativ gut verstanden sind, bleibt die genaue Quantifizierung der Kohlenstoffsenken an Land eine Herausforderung. Kleine Störungen in tropischen Wäldern, die in der Regel weniger als zwei Hektar groß und schwer zu erkennen sind, veranschaulichen diese Herausforderung. Obwohl sie nur 15 Prozent der betroffenen Fläche ausmachen, waren sie zwischen 1990 und 2020 für 88 Prozent des Netto-Kohlenstoffverlusts der Biomasse verantwortlich.
Verfolgung der Kohlenstoffdynamik aus dem Weltraum
Das RECCAP-2-Projekt nutzt Satellitendaten, um eine der größten Herausforderungen der Klimawissenschaft anzugehen: zu verstehen, wie und wo Kohlenstoff auf der Landoberfläche des Planeten gespeichert und freigesetzt wird. Durch die Kombination von Satellitenbeobachtungen mit Bodendaten und Computermodellen ist das Projekt in der Lage, den dynamischen Kohlenstoffaustausch zwischen Land und Atmosphäre zu quantifizieren und unabhängige Schätzungen der regionalen Kohlenstoffbilanzen zu liefern, die mit nationalen Inventaren verglichen werden können.
Während diese laufenden Forschungen die Kohlenstoffdynamik auf der ganzen Welt weiter analysieren, zeigen die bisherigen Ergebnisse kritische Trends auf, die dringend Aufmerksamkeit erfordern.
Der beschleunigte Kohlenstoffverlust im Amazonasgebiet
Das Amazonasbecken, das jährlich 14 Prozent der globalen Kohlenstoffaufnahme durch Pflanzen ausmacht, verlor zwischen 2010 und 2020 370 Millionen Tonnen Kohlenstoff, wobei der südöstliche Teil besonders betroffen war. Das Becken weist weiterhin einen beschleunigten Kohlenstoffverlust auf, was zu Besorgnis über mögliche Kipppunkte führt.
Nordwälder wandeln sich von Senken zu Quellen
Satellitendaten haben eine grundlegende Veränderung in den borealen und gemäßigten Wäldern der nördlichen Hemisphäre festgestellt, die 41 Prozent der weltweiten Waldfläche ausmachen. Wälder, die einst zuverlässige Kohlenstoffsenken waren, sind seit 2016 zu Kohlenstoffquellen geworden, was auf zunehmende Dürren, Waldbrände und andere klimabedingte Belastungen zurückzuführen ist.
Rückläufige Kohlenstoffaufnahme der Wälder in Europa
Zwischen 1990 und 2022 haben die Wälder in Europa etwa 10 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU absorbiert. Allerdings nimmt die Kohlenstoffaufnahme der Wälder aufgrund von Abholzung, Alterung, Dürre und Krankheiten ab – ein Trend, der erhebliche Auswirkungen auf die Klimaneutralitätsziele der EU bis 2050 hat.
Der unersetzliche Wert von Primärwäldern
Die Erholung der Wälder gibt zwar Anlass zur Hoffnung, doch Untersuchungen zeigen, dass Sekundärwälder und degradierte Wälder nur etwa ein Viertel des durch Abholzung verlorenen Kohlenstoffs zurückgewinnen. Dies unterstreicht, dass der Schutz alter Wälder weiterhin Priorität haben muss, da ihre Kohlenstoffspeicherkapazität durch Nachwachsen nicht vollständig ersetzt werden kann.
Die verborgene Bedeutung von nicht lebendem Kohlenstoff
Am überraschendsten ist vielleicht, dass Untersuchungen ergeben haben, dass der Großteil der Kohlenstoffaufnahme durch Landflächen in den letzten drei Jahrzehnten in nicht lebenden Reservoirs wie Böden, Totholz und Sedimenten stattgefunden hat. Zwischen 1992 und 2019 wurden nur 6 Prozent der 35 Gigatonnen Kohlenstoff, die von Landflächen aufgenommen wurden, in lebender Vegetation gespeichert. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass Kohlenstoffspeicher in nationalen Inventaren oft unterrepräsentiert sind, und unterstreicht die Notwendigkeit umfassender Überwachungssysteme, die das gesamte Spektrum der Kohlenstoffdynamik an Land erfassen.
Erdbeobachtungsmissionen zur Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen
Die Überwachung dieser Veränderungen erfordert kontinuierliche globale Beobachtungen aus dem Weltraum. Die wachsende Zahl von Erdbeobachtungsmissionen der ESA liefert die dafür erforderlichen kritischen Klimadaten.
BIOMASS – ein Earth Explorer der ESA – verfolgt die Kohlenstoffvorräte tropischer Wälder mit beispielloser Genauigkeit und liefert wichtige Daten über den Zustand der Wälder weltweit.
EarthCARE – ein Earth Explorer der ESA – befasst sich mit wolkenbedingten Klimaschwankungen, die unser Verständnis der Energiebilanz der Erde beeinflussen.
HydroGNSS – die erste Scout-Mission der ESA – wird die Bodenfeuchte überwachen, eine wichtige Variable für die Quantifizierung des Kohlenstoffaustauschs zwischen Land und Atmosphäre und die Funktionsweise terrestrischer Ökosysteme.
SMOS – ein Earth Explorer der ESA – nutzt L-Band-Mikrowellenbeobachtungen zur Überwachung der Bodenfeuchte und der optischen Tiefe der Vegetation. Seine Daten werden auch in der RECCAP-2-Forschung verwendet, um Veränderungen der Biomasse in den nördlichen Wäldern zu verfolgen.
Die Copernicus-Sentinel-Satelliten überwachen kontinuierlich Landflächen, Vegetation, Ozeane, Eisschilde und die Atmosphäre. Sentinel-6B, dessen Start für November 2025 geplant ist, wird die wichtige Überwachung des Meeresspiegels fortsetzen. Die bevorstehende Copernicus-Mission zur Überwachung anthropogener Kohlendioxidemissionen wird Kohlendioxid- und Methanemissionen überwachen und unabhängige Daten liefern, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Emissionsreduzierung auf nationaler und globaler Ebene zu bewerten.
Der Moment der Wahrheit in Belém
Wenn fast 200 Länder in Belém zusammenkommen, könnte die Lage kaum spannender sein. Im Rahmen der Global Stocktake, die alle fünf Jahre im Rahmen des Pariser Abkommens stattfindet, werden die gemeinsamen Fortschritte bei der Erreichung der Klimaziele bewertet.
Die vom CCI RECCAP-2-Team entwickelten neuartigen Methoden, die auf Erdbeobachtung und Atmosphärenmodellierung basieren, bieten eine Möglichkeit zum Vergleich von Treibhausgasinventaren.
Derzeit verwenden die meisten Länder Schätzungen der sektoralen Aktivitäten, um ihre nationalen Treibhausgasberichte zu erstellen und die Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur CO2-Reduzierung im Rahmen des Pariser Klimaabkommens darzustellen. Der Weltklimarat (IPCC) fordert die Vertragsparteien jedoch auf, die gemeldeten Emissionen anhand unabhängiger Messungen zu überprüfen, da dies die Transparenz fördert und den Fortschritt anhand empirischer Daten misst. Satellitenbeobachtungen bieten beides und liefern den Ländern Daten, mit denen sie die Fortschritte bei der Netto-Emissionsreduzierung überprüfen können, sodass diese die reale Welt widerspiegeln.
Simonetta Cheli, Direktorin der Erdbeobachtungsprogramme der ESA, erklärte: „Der Vergleich der Inversionsergebnisse mit den nationalen Treibhausgasinventaren kann regelmäßig zur Überwachung der Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik und der Fortschritte der Länder bei der Erreichung ihrer Ziele herangezogen werden.“
Die Wissenschaft ist sich einig: Klimaschutzmaßnahmen sind dringend erforderlich. Die Instrumente zur Überwachung sind vorhanden. Dank der von der ESA entwickelten Satelliten und Projekten wie RECCAP-2, die Beobachtungen in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, werden wir wissen, ob Klimaschutzmaßnahmen etwas bewirken. Was noch fehlt, ist der politische Wille zum Handeln – und zwar jetzt.
Quelle (Englisch): https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/ESA_satellites_track_progress_on_Paris_Agreement_goals